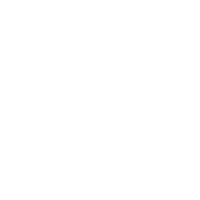Studierverhalten verstehen und einen Umgang damit finden.
Studierverhalten ergibt sich aus einem komplexen Zusammenspiel von individuellen, sozialen und institutionellen Faktoren, das entscheidend für den akademischen Erfolg ist (Weßeler & Ophuysen 2021). Es bezieht sich auf die Art und Weise, wie Studierende ihre Zeit und Ressourcen für das Lernen und die Partizipation an akademischen Aktivitäten nutzen, um erfolgreich zu studieren (Schulmeister 2022). Neben der Teilnahme an Lehrveranstaltungen, die verschiedene Ausprägungen haben kann (An-/Abwesenheit & No-Show), sind das Absolvieren von Prüfungsleistungen, das Selbststudium und die soziale Integration Indikatoren für das Studierverhalten (Buß 2019). Unter anderem durch die digitale Transformation, die Auswirkungen der Pandemie sowie den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen dieser Zeit sind neue Herausforderungen für Hochschulen, Dozierende und Studierende entstanden. So bleiben beispielsweise die individuellen Lebenslagen der Studierenden von den gesellschaftlichen Transitionen nicht unberührt: Die Studierendengesundheit hat sich laut dem "Gesundheitsreport 2023 – Wie geht es deutschen Studierenden" der Techniker Krankenkasse seit der Coronapandemie allgemein verschlechtert. Auch die Lebenslagen sind zunehmend heterogen. So pflegen beispielsweise 15% der Studierenden Familienangehörige, außerdem sind 63% der Studierenden nebenbei erwerbstätig (vgl. Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung 2023). Auch die Zunahme der "nicht-traditionell Studierenden" ist in Betracht zu ziehen (Dahm & Kamm 2022).
Die Fakultäten der Universität zu Köln und weitere Einrichtungen berichten folgendes: Sie beobachten und erleben vermehrt No-Shows und wenig stetiger Teilnahme in ihren Veranstaltungen. Und dies bleibt nicht folgenlos. Denn die Abwesenheit von Studierenden in Lehrveranstaltungen stellt für Hochschulen aus mehreren Gründen ein Problem dar (Schulmeister & Metzger 2019):
- schlechtere Studienleistungen,
- nicht effiziente Ressourcennutzung,
- sinkende Lehrqualität & Interaktivität,
- sinkende soziale & akademische Integration.
Das sind die Zielsetzungen
Um dem begegnen zu können, ist es von zentraler Bedeutung, das aktuelle Studierverhalten besser zu verstehen und Strategien im Umgang zu entwickeln. Das Projekt beschäftigt sich somit mit den Ausprägungen von Studienverhalten und erarbeitet Ansätze, um Studierende insgesamt zur aktiveren Teilnahme am Hochschulgeschehen zu motivieren. Das Ziel besteht darin, Möglichkeiten zur Steigerung der Studierendenpartizipation zu erarbeiten. Hierdurch kann mehr Verbindlichkeit in der Teilnahme an Lehr-Lernformaten entstehen. Zudem können Studierende durch Studierendenpartizipation erlernen, für ihre eigene Bildung und ihren akademischen Werdegang, sowie den Berufseinstieg und die gesellschaftlichen Herausforderungen Verantwortung und Engagement zu übernehmen (Mayrberger 2018, S. 40). Des Weiteren trägt eine aktive Studierendenpartizipation dazu bei, dass die Hochschulen demokratischer und partizipativer werden, indem die Studierenden mehr Mitbestimmungsrecht haben (Raffaele & Rediger 2021, S. 12).
Das sind die Fragen
- Wie studieren Studierende heutzutage?
Was sind typische Lerngewohnheiten, bevorzugte Lernmethoden und die Rolle von digitalen Medien im Studium?
- Was sind Gründe für No-Shows, Nicht-Teilnahme und weniger Partizipation?
Welche Faktoren führen dazu, dass Studierende Vorlesungen, Seminare oder andere Veranstaltungen nicht (stetig) besuchen oder sich weniger aktiv einbringen?
- Wie gehen Hochschulen mit dem veränderten Studierverhalten um?
Welche Anpassungen und innovativen Maßnahmen haben Hochschulen bereits ergriffen, um das Studierverhalten zu unterstützen und eine höhere Studierendenpartizipation zu fördern?
- Was (be-)fördert Studierendenpartizipation?
Welche Ansätze sind besonders erfolgreich, um Studierende zur aktiven Teilnahme am Hochschulgeschehen zu motivieren, sowohl in der Lehre als auch in der Hochschulentwicklung?
Das ist das Vorgehen
Es werden explorative Expert*inneninterviews mit Planendem und lehrenden Personal der Universität zu Köln durchgeführt. Der Leitfaden beinhaltet Fragen über das wahrgenommene Studierverhalten sowie über den Umgang mit Veränderungen und Herausforderungen sowie über mögliche Folgen für die Hochschule.
Der Forschungsstand zum Studierverhalten wird anhand eines systematischen literatur-Reviews (Newman & Gough 2020) aufgearbeitet. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über empirische Arbeiten zu erarbeiten, die sich mit der Thematik beschäftigen. Hierfür werden wissenschaftliche Datenbanken (FIS Bildung, Web of Science, ERIC, googlescholar, ...) mit festgelegten Suchtermen durchsucht.
Vor dem Hintergrund des partizipativen Ansatzes des Projektes gilt es, vor allem die Perspektive der Studierenden stark zu berücksichtigen. Hierfür werden partizipative Fokusgruppen mit Studierenden durchgeführt. Hierbei liegt der Fokus darauf, dass die Studierenden die zu beantwortenden Fragen selbst entwickeln.
Austausch und Transfer
Im Rahmen des Projektes werden regelmäßig digitale Treffen und Workshops über die Zwischenergebnisse durchgeführt, um hochschulweit in den Austausch treten zu können. So ergibt sich ein dialogischer Projektverlauf, der ermöglicht, Themen und Schwerpunkte, die im Austausch entstehen, in die laufende Forschungsarbeit einzubeziehen.
Organisation & Kontakt

Dr. Jana Arbeiter (sie/ihr)
Bereich Forschung
Kontakt
Telefon: +49 221 470-8319 (Di, Mi, Do)
E-Mail: jana.arbeiteruni-koeln.de
Erreichbarkeit
dienstags, mittwoch (Büro)
montags, donnerstags, freitags (Homeoffice)